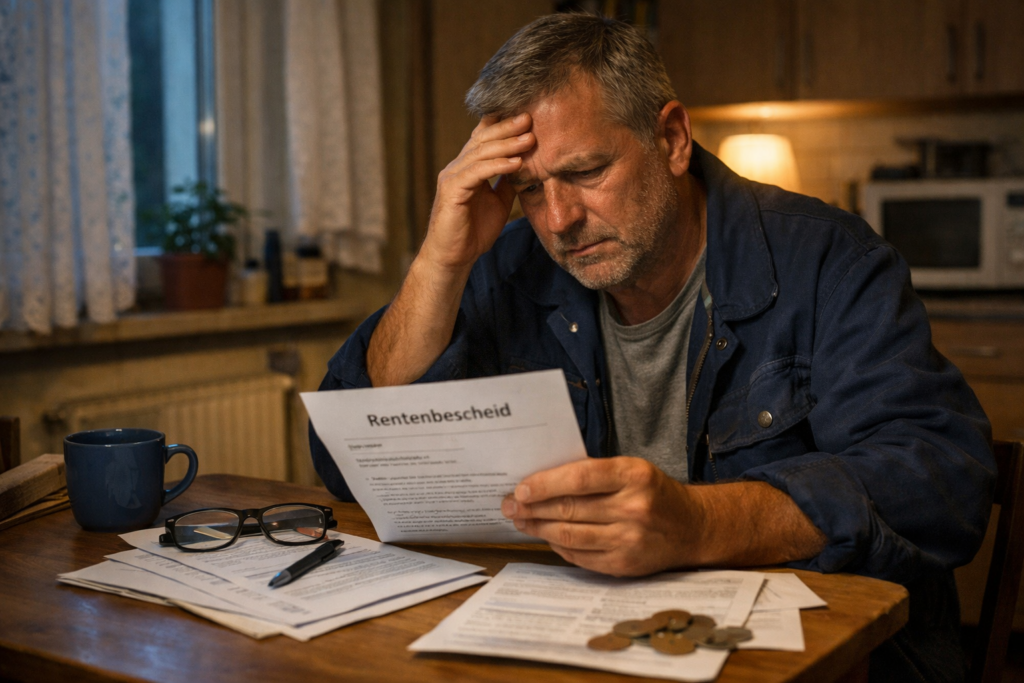Ein Beitrag von

Werner Hoffmann.
Manchmal braucht es keine langen Reden, keine politischen Programme und keine endlosen Talkshows. Manchmal reicht ein einziges Bild. Ein Kind. Ein Blick. Und ein paar einfache Worte auf einem T-Shirt.
„Geburtsort: Erde. Rasse: Mensch. Politik: Freiheit. Religion: Liebe.“
Diese vier Zeilen sind mehr als ein Statement. Sie sind eine Erinnerung. Eine Erinnerung daran, dass wir Menschen ursprünglich keine Grenzen kennen. Keine Parteiprogramme. Keine ideologischen Schützengräben.

Kinder denken nicht in Nationen. Sie denken nicht in Machtblöcken. Sie fragen nicht zuerst nach Herkunft oder Status. Sie sehen einen anderen Menschen – und reagieren mit Neugier. Mit Offenheit. Mit Vertrauen.
Doch irgendwo auf dem Weg ins Erwachsenenleben verlieren viele genau diese Fähigkeit. Wir lernen zu unterscheiden. Zu bewerten. Zu misstrauen. Wir übernehmen Begriffe, die trennen, statt zu verbinden.

Gerade in Zeiten politischer Polarisierung wirkt ein solcher Satz fast provokativ. Denn er stellt die simpelste aller Fragen: Was wäre, wenn wir uns wieder stärker als Menschen begreifen würden – und weniger als Vertreter von Lagern?

Freiheit bedeutet nicht nur Wahlrecht oder Meinungsfreiheit. Freiheit bedeutet auch, sich nicht von Angst und Abgrenzung treiben zu lassen. Und Liebe ist nicht nur ein privates Gefühl. Sie ist auch eine gesellschaftliche Haltung: Respekt. Empathie. Verantwortung.
Vielleicht ist die größte Stärke einer Demokratie nicht ihre Härte – sondern ihre Menschlichkeit.
Und vielleicht brauchen wir deshalb manchmal genau solche Bilder. Nicht, weil sie naiv sind. Sondern weil sie uns daran erinnern, wie klar die Welt wirken kann, wenn man sie mit Kinderaugen betrachtet.

Geburtsort: Erde.
Rasse: Mensch.
Politik: Freiheit.
Religion: Liebe.
Eigentlich ist das alles.
#Menschlichkeit #Freiheit #Demokratie #Zusammenhalt #Zukunft











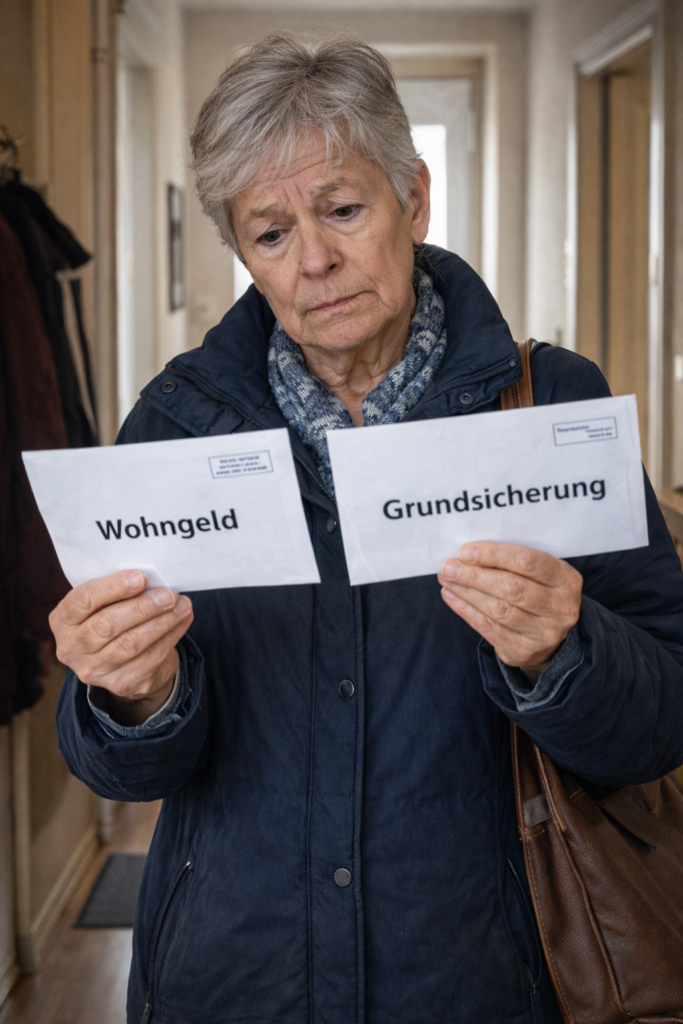












 Jetzt direkt anrufen:
Jetzt direkt anrufen:  Jetzt per WhatsApp kontaktieren
Jetzt per WhatsApp kontaktieren